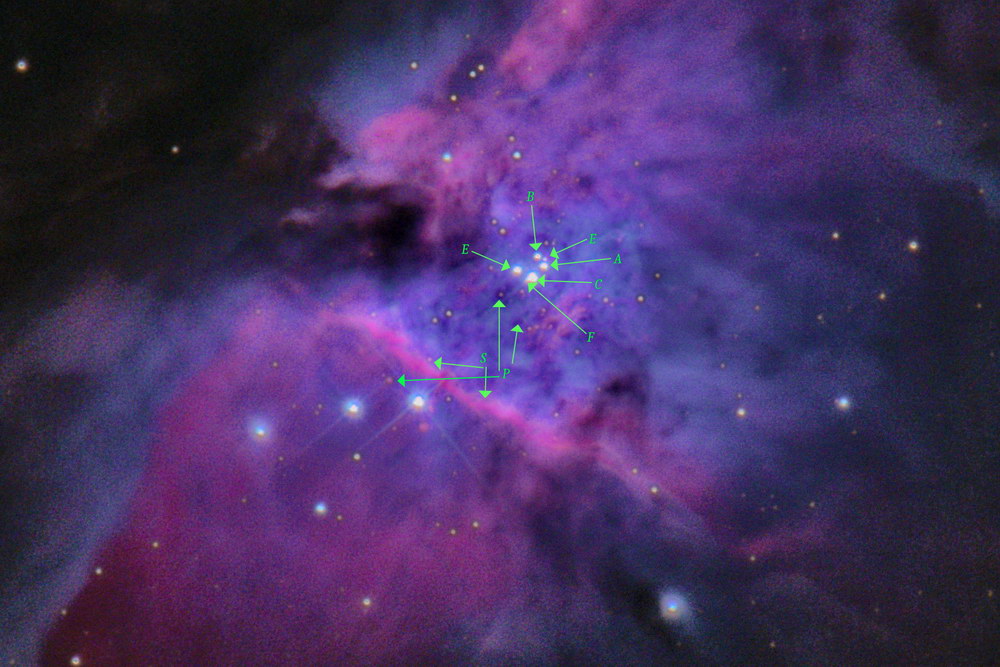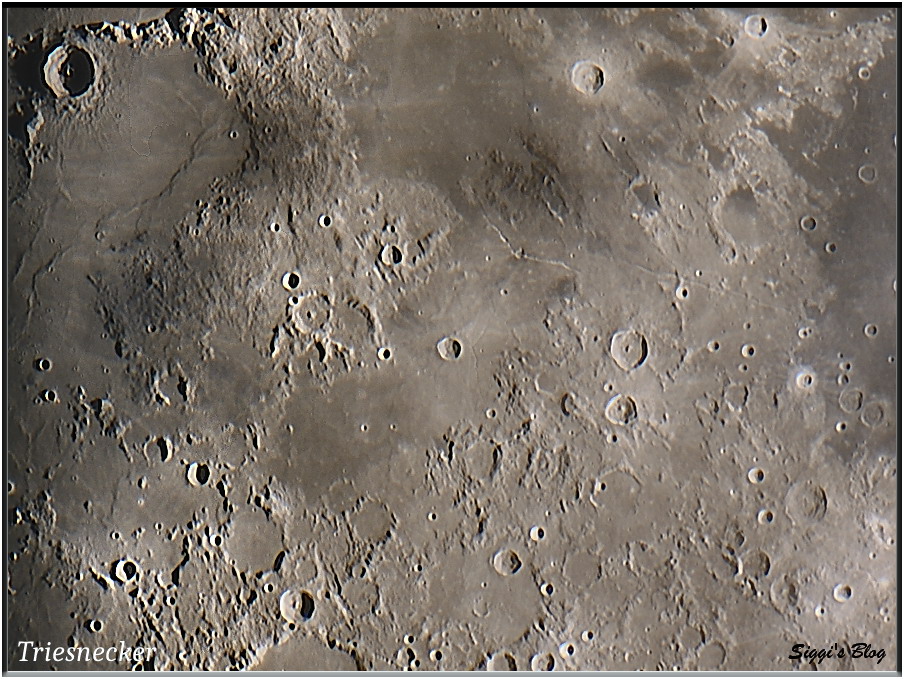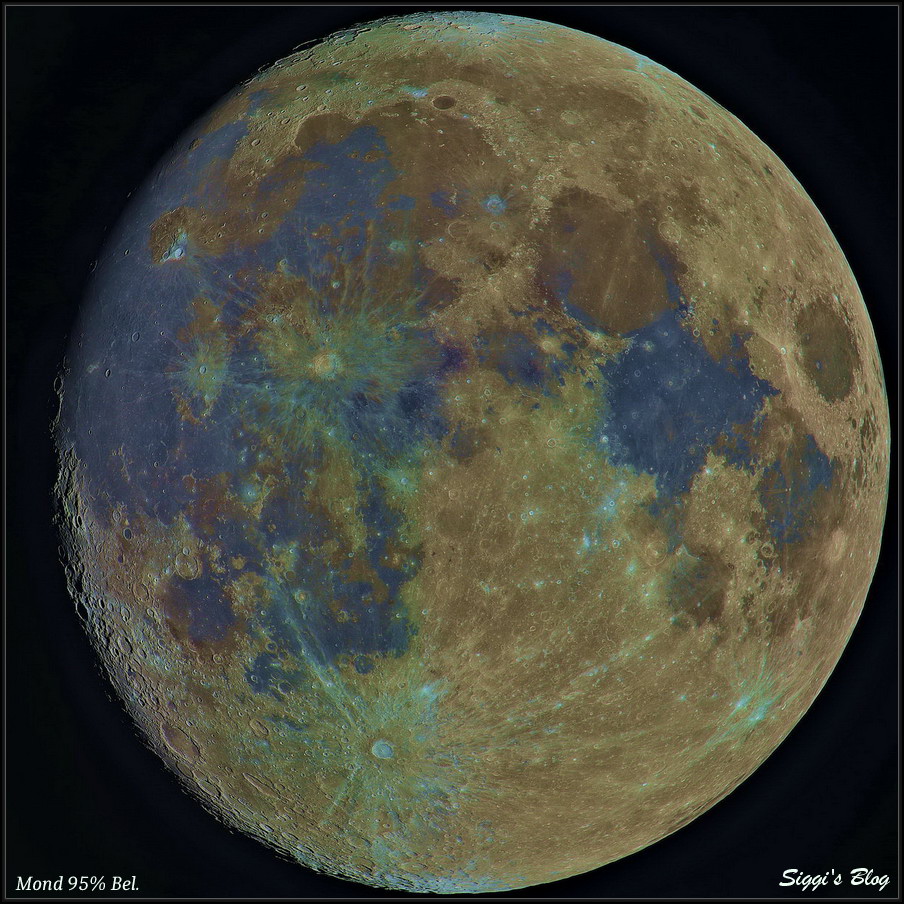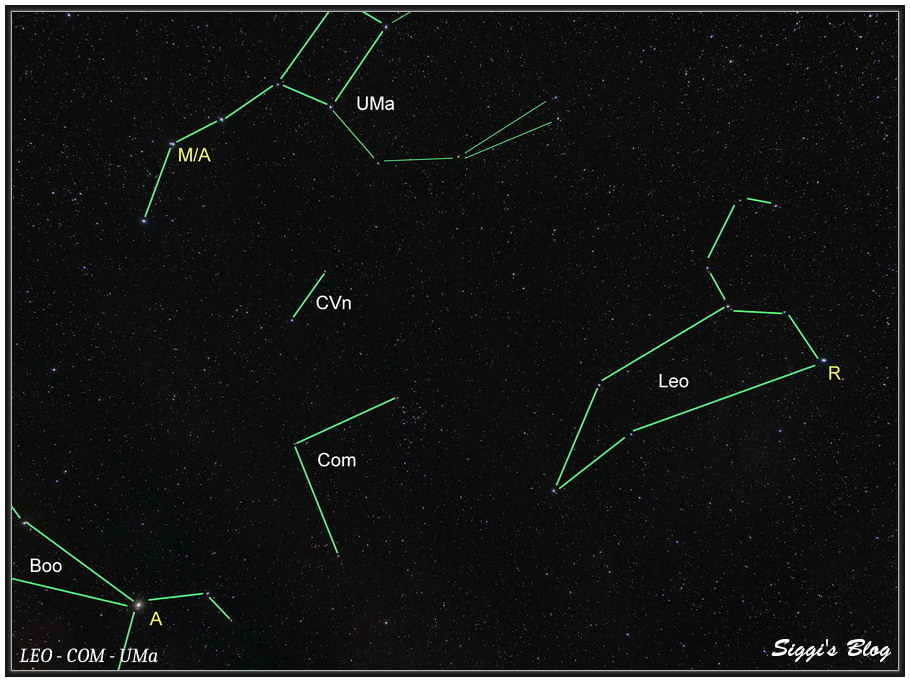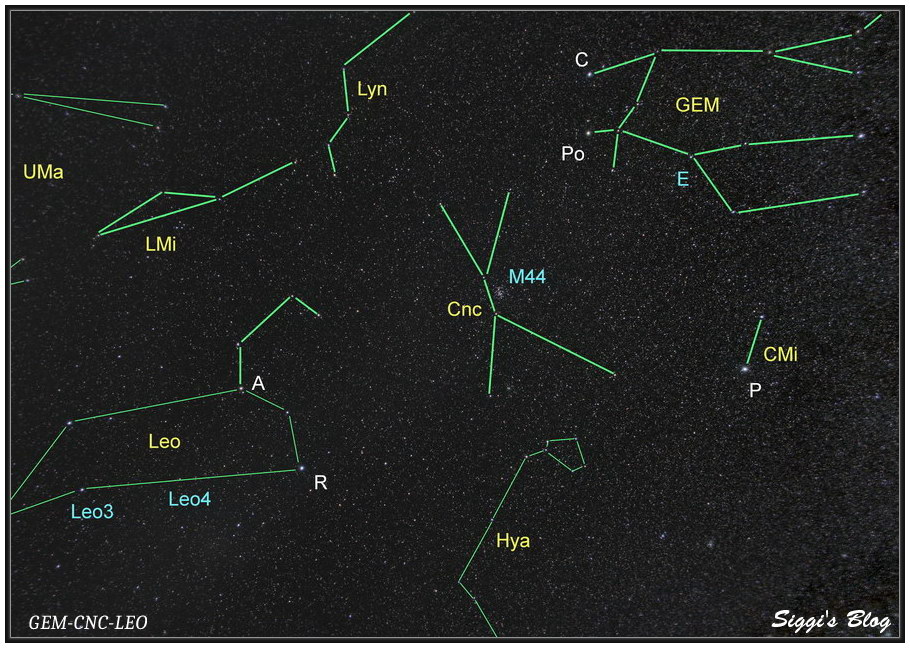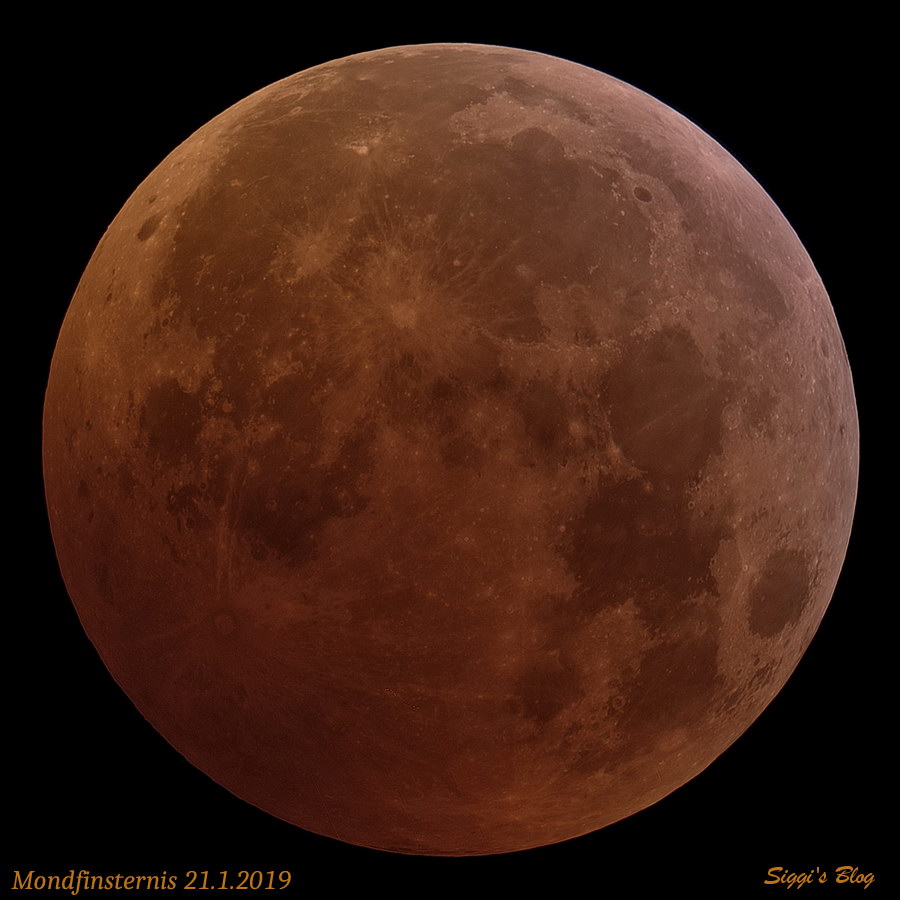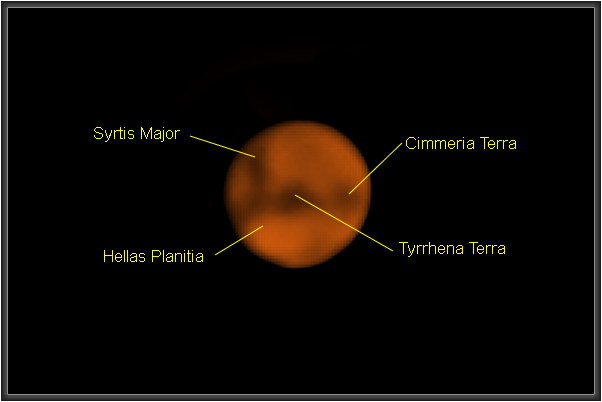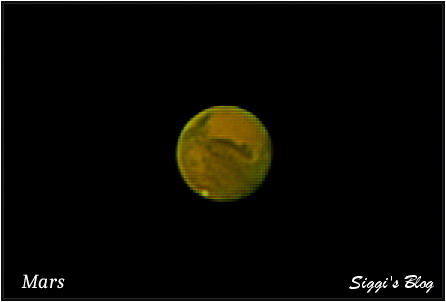Was jeder schnell mitbekommt: Im Winter sind die Tage kurz im Sommer lang.
Das gerade im Winter die Erde der Sonne am nächsten ist, wissen aber schon weniger.
Spätestens wenn jemand mal die Milchstraße fotografieren will, muss man
dann etwas nachforschen. Zumindest will man herausfinden wo man sie zu
suchen hat und dabei kommt man dann weiter drauf, dass sie im Laufe der
Jahreszeiten wandert.
Bleiben wir aber jetzt mal im Sonnensystem:
Die Jahreszeiten kommen ja daher, weil die Erdachse gekippt steht.
Steht die Sonne tief, fallen die Strahlen flach auf die Erdoberfläche
auf, was weniger Energie/Fläche bedeutet. Betrachten wir die Extreme,
dann steht die Sonne zur Sommersonnenwende über dem „Wendekreis des
Krebses“ im Zenit zu Herbst und Frühlingsbeginn über dem Äquator und im
Winter ist sie im südlichen Wendekreis „Wendekreis des Steinbocks“ genannt.
Da ich schon öfter gerade den nördlichen Wendekreis (Krebs) überschritten habe: Er ist zwischen Assuan und Abu Simbel, falls sich jemand in Ägypten auskennt. Marokko, Miami und Dubai liegen da auch in etwa, so zur Orientierung. Der Südliche geht z.b. durch Namibia. Es ist der 23 Breitengrad. Das ganze wandert aber etwas.
Da
bedeutet: die Sonne steht bei uns in der nördlichen Hemisphäre nie im
Zenit, aber der Tag ist damit sehr lang, und je höher man in den Norden
kommt, desto weniger lang finster wird es in der Nacht. Die „Astronomische
Finsternis“ ist bei uns im Sommer im Süden von Deutschland und bei mir
um Wien herum gerade mal so 1 Stunde lang verfügbar. Im hohen Norden
über dem Polarkreis geht dann sie Sonne nicht mehr unter und auch ein
paar hundert km südlich wird es nie mehr richtig dunkel. Das sind die
berühmten weißen Nächte in St. Petersburg.
Umgekehrt im Winter: Hoch oben am Polarkreis ist ewige Finsternis oder gerade mal etwas dämmrig über den Tag und bei uns ist nur 8 Stunden Tag.
Und wer sich auf die Südhalbkugel der Erde begibt hat das genau umgekehrt: Wenn bei uns Winter ist, ist „unten“ Sommer.
Sonne, Planeten
und unseren Mond findet man entlang der Ekliptik. Die steht im Winter
besonders hoch im Sommer sehr tief. So erreicht der Mond im Winter
seinen Höchststand. Und je höher über dem Horizont etwas steht, desto
dünner ist die Atmosphäre, die uns das Fotografieren so verschlechtert.
Das Seeing hat natürlich auch viel mitzureden und das ist im Frühling am
besten. Und wie wir wohl auch immer ab Herbst mitbekommen: Meist ist es
bewölkt und zäher Hochnebel sorgt dafür, dass trotz langer Nächte sich
die brauchbaren Zeiten auf einige wenige Stunden im gesamten Winter reduzieren.
Astronomische Beobachtungen waren seit jeher bei den Menschen
überlebensnotwendig, zeigen sie doch, wo im Jahr man steht, was wichtig
für die Ackerbau ist. So ist es wenig verwunderlich, dass man auf
Höhlenzeichnungen die Plejaden identifizieren kann und sie auch auf der
Himmelscheibe von Nebra vorkommen. Ihr Erscheinen zeigt nämlich an wenn
es Herbst wird, ihr Verschwinden vom Abendhimmel den Frühling. Der Sirus
zeigte den Ägyptern, dass die Überschwemmungen kommen, die dann wieder
fruchtbaren Boden bringen.
Dieses Wissen bedeutete Macht und wurde lange von den Priestern
gehütet. Erst mit genauen Kalendern brauchte es diese „Insider“ nicht
mehr, denn es genügte ein Blick auf den Kalender und man wusste wo im
Jahr man sich befand.
Schon vor sehr langer Zeit sahen die Menschen in den auffälligen
Sternanordnungen (Asterismus) schon bald Dingen des Alltags, meist
wurden aber Gestalten aus der Sagenwelt in den Himmel gesetzt. Helle
Sterne erhielten Namen und wenige verwunderlich kommen sie aus dem
Arabischen und Griechischen.
Was auffällt: Je mehr man in den Süden geht, desto mehr Gerätschaften
etc. der letzten paar Jahrhunderte wurden in den Himmel gesetzt: Fornax
(Chemischer Ofen) Skulptor (Bildhauer) Mikroskop, Carina (Schiffskiel)
etc. Das Kreuz des Südens war wichtig für die Seefahrt, denn es gibt da
keinen auffälligen Stern der der Südpol am Himmel kennzeichnet.
Dann wurde so um 1600 das Wort Astrologie (=Sterndeutung) geschaffen,
aber die Wurzeln gehen mehr als 2000 Jahren zurück. Nun musste Platz für
die Tierkreiszeichen (=Zodiak) geschaffen werden. Und zwar brauchte es
12, einen für jeden Monat. Davor waren es 13.
Man musste sie natürlich entlang der Eklipik angeordnet, denn da
bewegen sich ja scheinbar Sonne, Mond und Planeten (Wandelsterne) durch.
Für den ungeübten Beobachter sind dabei diese Sternbilder sehr oft
nicht einfach zu finden, denn sie bestehen oft nur aus schwachen
Sternen. Bei einigen kann man zumindest die helleren Hauptsterne
identifizieren.
Warum ich das jetzt ausbreite: Es hat damit zu tun, wann man etwas sehen kann.
In welchem Sternzeichen jemand geboren ist, wurde dadurch definiert, dass im Sternbild gerade die Sonne steht.
Das bedeutet für uns: Das eigene Sternbild ist um den Geburtstag herum
nicht zu sehen, denn da steht die Sonne und überstrahlt alles davor und
danach. Am besten ist es sichtbar wenn es genau gegenüber der Sonne
steht, als ein halbes Jahre danach, zu Mitternacht. Da ist der
„Meridiandurchgang“ und auch der höchste Stand über dem Horizont in der
Nacht, denn am Tag haben wir ja nichts davon… zumindest nicht wenn man
es beobachten will.
Ich empfehle immer die Freeware Stellarium und wer da jetzt mal
Nachprüft wird feststellen: Das ganze Zeugs stimmt um einen Monat nicht
mehr….. Daher müssten wir jetzt auch anstatt des Wendekreis des Krebs
vom Wendekreis des Zwillings und anstatt Steinbock den Schützen
anführen.
Und wer jetzt weiß, dass die schöne helle Sommermilchstraße im
Sternbild Schütze steht wird jetzt ableiten können, warum man diesen
Bereich nur eher im Sommer schön sehen kann, denn im Winter ist da die
Sonne.
Bedingt durch die Abweichung des Horoskop um ein Sternbild ist es heute
dennoch möglich zumindest Teile des Sternbild zu seinem Geburtstag kurz
nach Sonnenuntergang zu sehen.
Wenn man jetzt eine gewisse Region am Himmel ansieht, wird diese zu
einem immer früheren Zeit am Himmel zu sehen sein. Wer die ganze lange
Nacht, vor allem im Winter ? zusieht wird
dabei einen großen Teil der Sternbilder die es so gibt vorbeiziehen
sehen. Jetzt im Jänner sieht man schon morgens die Sommersternbilder,
schon nach Mitternacht die Frühlingssternbilder. Und am Abend kann man
im Westen die Sommersternbilder (Schwan z.b.) oder Vega verschwinden
sehn und am Morgen im Norden vorbeizieht, allerdings zu tief, als dass
man fotografisch was gutes bekommt.
Aber es hilft sich am Sternenhimmel zurechtzufinden.
Bedingt durch die Erdachse gibt es Sternbilder, die man bei uns das
ganze Jahr über sieht bzw. Teile davon. Die nennt man Zirkumpolar. Das
ist der große Wagen, Kassiopeia (diese W am Himmel) und die helle
Capella.
Will man ein bestimmtes Objekt beobachten, kann man selten die ganze
Sichtbarkeit über die Nacht verwenden, sondern hat oft nur einen mehr
oder weniger begrenzten Bereich, wo es Aufgrund der örtlichen
Gegebenheiten (Bäume, Lichtverschmutzung) sinnvoll ist. Das muss man
dann auch in seine Kalkulationen miteinbeziehen.
Zum Teil ist dieses Sichtfenster halt recht eng und wenn man es
versäumt dann bleibt einem vielleicht den Standort zu wechseln oder ein
Jahr zuwarten bis es wieder vorbeikommt.
Keine Angst, wenn man öfter in die Sterne schaut, lernt man schön
langsam dazu und bekommt das dann auch mit wie alles wandert. Dazwischen
liegt halt fast ein Jahr, aber je öfter man etwas wiederholt, desto
besser verinnerlicht man es.
Zurück ins Sonnensystem:
Wer die Planeten beobachtet sieht, dass sie nicht gleichförmig in eine
Richtung wandern, sondern in Schleifen. Das gab lange Zeit ein Rätsel
auf, aber nur solange bis man die Erde aus dem Zentrum des Sonnensystems
an die richtige Stelle rückte. Damit war dann leicht erklärbar, warum
die mal in eine Richtung wandern bis sie dann scheinbar umdrehen und
Rückläufig sind.
Entlang der Ekliptik gibt es ja einige helle Sterne, die natürlich
benannt wurden und ab und an gibt es da Bedeckungen, vor allem durch den
großen Mond.
Der Mond selber unterliegt einem monatlichen Zyklus, der ca. 28 Tage
dauert. Nicht umsonst ist z.B. der Zyklus der Frauen auch in etwa 28
Tage. Mit unsere künstlichen Lichtquellen ist das aber auch oft schon
verschoben und verwaschen. Ansonsten war um den Vollmond (=hell) meist
der Eisprung, um wieder mal abzuschweifen ?
Eines ist sicher: Die Sterne und anderen Planeten üben keinen
unmittelbaren Einfluss auf die Menschen aus. Aber beim Mond merkt man es
schon alleine durch Ebbe und Flut. Und so mancher ist „mondsüchtig“.
Die Sonne unmittelbar durch ihre Aktivitäten, die aber nur wenige mit
eigenen Augen sehen: Polarlichter. Und so einen richtiger Hit ausgelöst
durch extreme Sonnenwinde hatten wir die letzten 2 Jahrzehnte zum Glück
nicht mehr. Bei der heutigen Abhängigkeit von
Telekommunikationssatelliten und Stromversorgung merken wir es dann aber
schon wenn es doch passiert…
Auch wenn uns der Mond durch Synchronisationseffekte immer die selbe
Seite zeigt, ganz so ist es nicht. Er zeigt uns mal mehr und mal weniger
von seiner Nord, Süd, Ost oder Westseite. Das nennt sich Liberation.
Innerhalb eines Monats schwankt auch sein Abstand zur Erde und war
zwischen 356 400 und 406 700km. Visuell ist der Größenunterschied aber
nur maximal um die 15%. Man wird auch feststellen dass er ca. 1 Stunde
pro Tag später aufgeht.
Da er am Nachthimmel einer der stärksten „Lichtverschmutzer“ ist, kann
man dann abschätzen, wann man wieder besser Beobachtungsbedingungen hat.
Also rund um den Neumond. Oder zumindest bis Mondaufgang oder beim
Monduntergang.