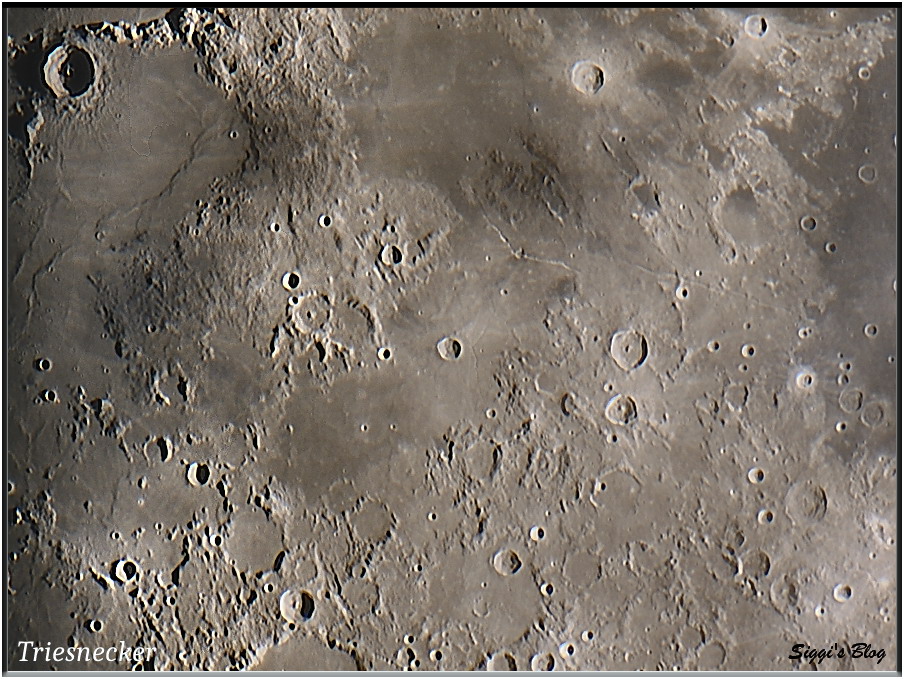In letzter Zeit nehmen die Sensationsmeldungen über den Supermond leider überhand: Alles nur mehr um Klicks zu generieren.
Vor einigen Tagen (so ab 18/19.10.2025) nur überschattet von der Meldung, dass am 21.10.25 ein Komet (C/2025 K1) näher als der Mond steht der über Wochen lang sichtbar sein wird. Jeder weiß mittlerweile, dass das nicht so eingetreten ist, etwas Wissendere allerdings schon vorher dass es Quatsch ist.
Meine Reaktion auf solche Meldungen der Kanäle, die alles voneinander ungeprüft verbreiten: blockieren, manches mal vorher mit der Anmerkung dass das „BS“ ist. Leichter kann man unseriöse Quellen nicht erkennen.
Schon beim letzten Vollmond Mal (10/25) wurde schon davon gesprochen. Da war der Vollmond morgens 5:48, aber einen Tag später um 15:67 wurde die größte Erdnähe erreicht.
Der November Vollmond am 5.11.2025 ist da schon passender: Der wäre dann um 14:20 und 23:56 erreicht er dann auch sein größte Erdnähe mit 356 900 km.
Naja und beim übernächsten Vollmond (5.12.) wird die größte Erdnähe dann am Tag davor eintreten.
Den Begriff „Supermond“ hat ein Amerikanischer Astrologe um 2000 eingeführt und meint einen Vollmond in Erdnähe.
Das tritt übrigens ca. alle 14-15 „Lunationen“ auf, genauer: 413,3 Tage. Die Supermondmeldungen mussten wir also relativ spärlich über uns ergehen lassen.
Leider hat in letzter Zeit jemand etwas ausgegraben, wonach offenbar bei der NASA eine „Definition“ geschaffen wurde, wonach jeder Vollmond mit einem Abstand kleiner 360 000km als Supermond gilt…..
Jetzt haben wir gleich 3 Supermonde statt Einem.
Das Erde/Mond-System hat aber doch recht komplizierte Zusammenhänge und wenn man die maximale und minimale Entfernung zur Erde (Erdmittelpunkt/Mondmittelpunkt) ansieht zwischen dem Jahr 1500 und 2500 haben wir sowieso verloren 😉 :
In „unserer Zeitspanne“ taucht(e) das gerade mal 1984 mit einer Erdferne von 406 712km und 2052 (6.12.) mit Erdnähe von 356 421km auf.
Rekorde was Erdnähe betrifft wäre 2257 (1.1. – wenn es jemand in den Terminkalender eintragen will 😉) mit „nur“ 356 371km und für den kleinsten Mond wären sogar 2 Termine vorzumerken: 2125 und 2266 mit 406 720 km
Dabei schwanken die Größenunterschiede zwischen Perigäum und Apogäum zwischen 12,5%-14,1%